
Partner*innen der UN-Dekade
Gemeinsam für unsere Ökosysteme
Unsere Ökosysteme brauchen Unterstützung – und mehr Sichtbarkeit in der öffentlichen Wahrnehmung. Deshalb engagieren sich Partner*innen aus Politik, Wissenschaft, Gesellschaft und Kultur für die UN-Dekade.
Neben prominenten Partnerinnen und Partnern sind auch junge Menschen aktiv beteiligt: Nachwuchswissenschaftler*innen aus verschiedenen Disziplinen besuchen Projekte vor Ort, bringen ihre Perspektiven auf aktuelle Entwicklungen ein und begleiten die Social-Media-Arbeit der UN-Dekade in Deutschland. Ihr Einsatz zeigt: Der Schutz und die Wiederherstellung von Ökosystemen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.



Intakte Ökosysteme sind die Grundlage unseres Lebens, doch leider sind viele von ihnen gefährdet. Daher ist es entscheidend, dass wir uns auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene für ihren Schutz und ihre Wiederherstellung einsetzen. Schleswig-Holstein hat dabei eine besondere Verantwortung. Wir haben nicht nur wertvolle Landökosysteme, sondern mit Nord- und Ostsee auch Anteile an zwei Meeren.
Vor allem der ökologische Zustand der Ostsee macht uns dabei Sorgen. Unsere Biodiversitätsstrategie "Kurs Natur 2030" hat daher die Wiederherstellung der Land- und der Meeresökosysteme im Blick und ist ein Schwerpunkt für die Landespolitik. Mit der laufenden UN-Dekade zur Wiederherstellung von Ökosystemen bleibt der Schutz und die Regeneration der Natur in unserem Fokus. Schleswig-Holstein macht sich weiterhin stark für die Natur – denn Natur ist Zukunft.


Allein in Nordrhein-Westfalen leben fast 43.000 verschiedene Tier-, Pilz- und Pflanzenarten in rund 70 verschiedenen Lebensräumen. Viele davon sind durch den Klimawandel bedroht. Diesen Reichtum für unsere Kinder und nachfolgende Generationen zu erhalten und Verantwortung zu übernehmen – das ist Aufgabe der Politik. Wir in Nordrhein-Westfalen haben im Jahr 2021 das erste eigenständige Gesetz zur Klimaanpassung bundesweit geschaffen, um die Widerstandsfähigkeit von Umwelt, Natur und Menschheit zu stärken. In 2023 haben wir als Landesregierung ein Klimaschutzpaket für die Weiterentwicklung des NRW-Klimaschutzgesetzes mit 68 Maßnahmen in sieben zentralen Handlungsfeldern auf den Weg gebracht. Mehr als eine Milliarde Euro stehen für die Jahre 2023 und 2024 für Klimaschutzmaßnahmen im Landeshaushalt bereit.
Wir entwickeln unablässig Instrumente und Maßnahmen zum Schutz und zur Regenerierung unserer Ökosysteme. Die Erklärung der Jahre 2021 bis 2030 zur UN-Dekade zur Wiederherstellung von Ökosystemen ist für uns alle der Aufruf, unsere Umwelt, Natur und Artenvielfalt gemeinsam zu schützen. Hierbei zu helfen, ist mir ein persönliches Anliegen.


Die Wiederherstellung von Ökosystemen ist eine zwingend notwendige Maßnahme, um den Klimawandel und das Artensterben einzudämmen. Gelingt uns das nicht, wird die Zukunft richtig ungemütlich – schließlich basiert ein großer Teil der globalen Wertschöpfung auf den uns umgebenden Ökosystemen. Kollabieren diese, ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch die menschliche Zivilisation ins Straucheln gerät.
Wir entscheiden in den nächsten Jahren die Marschrichtung der Menschheit für die nächsten Jahrhunderte. Reißen wir einige Kippunkte des Systems Erde, wird die Zukunft ungemütlicher als wir uns das je hätten vorstellen können.


Ohne intaktes Ökosystem kann es kein menschliches Leben geben.
Ob Überfischung der Meere und Zerstörung der Korallenriffe, Verschmutzung von Gewässern oder Trockenlegung von Mooren, trotz existenzieller Bedeutung sind die Ökosysteme weltweit bedroht. Initiativen wie die zum Schutz der Moore in Mecklenburg-Vorpommern zeigen aber auch, dass durch aktives Handeln Klimaschäden beträchtlich vermindert werden können.
Als Ministerpräsidentin des Saarlandes sehe ich es daher als eine zentrale Aufgabe, mich aktiv für den Kampf gegen den Klimawandel und für den Erhalt der Ökosysteme einzusetzen. Aktuell verfolgt das Saarland verschiedene Programme und hat eine eigene Biodiversitätsstrategie zur Erhaltung und Optimierung biologischer Vielfalt entwickelt.
Zusätzlich zu unseren regionalen Bemühungen ist die UN-Dekade ein wichtiges und hilfreiches Instrument, um die Relevanz der Ökosysteme in Gesellschaft und Politik noch stärker zu verdeutlichen und dadurch politische Initiativen aktiv zu fördern.
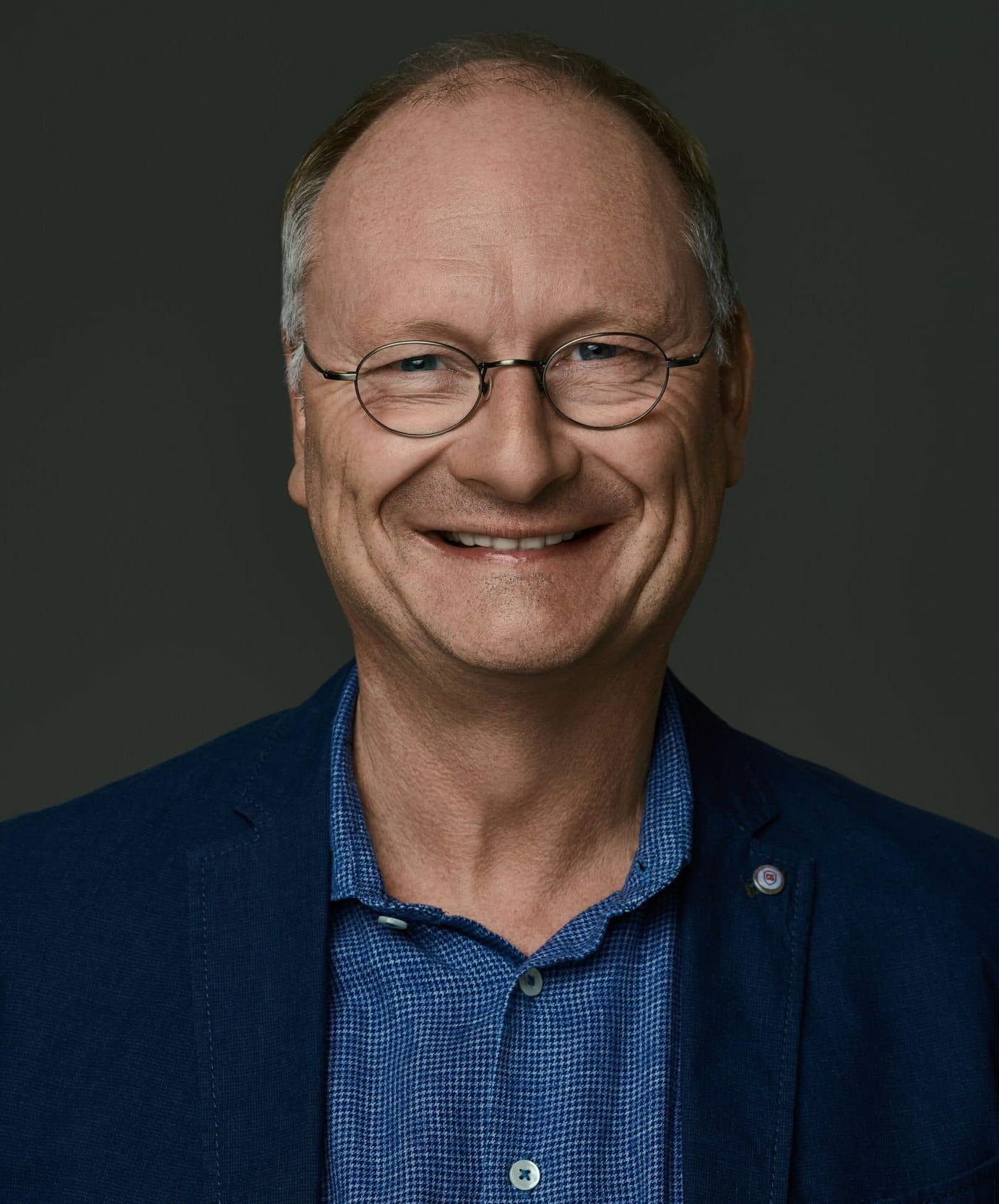

Wenn man aus dem Weltall auf die Erde schaut, dann – so sagen es alle Astronautinnen und Astronauten, die man fragt – macht das Herz vor lauter Faszination ein paar Extrahüpfer. Betrachtet man die zierliche Lufthülle, die unseren blauen Planeten umgibt, ist die größte Empfindung wohl ein ungeheuerlicher Respekt. Luft und Wasser sind unsere Lebenselixiere, und sie sind „einfach so da“. Danke! Und was machen wir, die selbsternannte "Krone der Schöpfung“? Im Moment so ziemlich das Gegenteil von "Respekt zollen“! UN-Generalsekretär António Guterres hat es 2022 in klare Worte gekleidet: "Wir sind auf dem Highway in die Klimahölle!“. Ein Highway hat Ausfahrten. Wir sollten die nächste nehmen!


Wir sind nach wie vor ein Bestandteil der Natur und damit nach wie vor abhängig von ihr. Ökosysteme zu schützen und wiederherzustellen dient damit zuallererst dem Schutz der Menschen. Um Flächen zu renaturieren oder wieder zur Wildnis werden zu lassen, müssen wir nichts abgeben, sondern wir tauschen etwas ein: Weniger Ressourcenverbrauch gegen mehr Freude. Alte Wälder, an denen es uns überall mangelt, sind so wunderbare Orte. Hier kann man sich nicht nur erholen und Tiere beobachten, sondern hier wird auch Klima gemacht! Schon Alexander von Humboldt wusste, dass Wälder die Landschaft kühlen und Regen erzeugen. Die moderne Forschung kann dies mit beeindruckenden Zahlen bestätigen. So kühlt ein intaktes Waldökosystem die Landschaft im Sommer durchschnittlich um 10 °C bis 15 °C herunter. Bäume haben also glücklicherweise dieselben Vorlieben wie wir: nicht zu heiß und nicht zu trocken. Und die gute Botschaft lautet: Zumindest in Mittel- und Westeuropa kommt der Wald überall dort von selber zurück, wo wir es zulassen. In Bezug auf Ökosysteme weniger tun, mehr zulassen – das ist die Botschaft, die uns Bäume senden würden, wenn sie könnten.


Nachhaltigkeit – das Aufhalten einer Abwärtsbewegung für die Nachwelt – ist nicht genug! Was wir brauchen, sind regenerative und progressive Ansätze. Ansätze, die zerstörte Funktionen wiederherstellen oder sogar darüber hinaus optimieren, die nicht nur negative Einflüsse reduzieren, sondern konstruktiv gestalten. Ansätze, die außerdem nicht aus Zielen, sondern aus zielstrebigen Handlungen bestehen. Wenn wir die Krisen unserer Zeit bewältigen wollen, müssen sich die Kulturlandschaften des 21. Jahrhunderts drastisch ändern. Insbesondere der Boden wird im Zentrum unserer Beachtung stehen müssen, wenn wir Ernährungssicherheit, sichere Wasserversorgung, funktionierende Ökosysteme mit Mehrwert für Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt sowie effektiven Klimaschutz wollen. Es folgt, dass wir es uns nicht mehr werden leisten können, aus Gewohnheit, Bequemlichkeit und ideologischen Barrieren heraus einen Wandel hinauszuzögern.


Wie wichtig und nachhaltig die Wiederherstellung von Ökosystemen ist, habe ich unmittelbar in meiner Heimat an der Mittelelbe erleben dürfen. An der Elbe sind etwa 80 Prozent der ursprünglichen Auen zerstört, verbaut oder komplett vom Fluss getrennt und verloren somit viele ihrer ökologischen Funktionen. Nach dem Jahrhunderthochwasser 2002 wurde über ein Naturschutzgroßprojekt der Elbdeich im Lödderitzer Forst auf 2,5 km vom Fluss entfernt zurückverlegt. Rund 600 Hektar Hartholzauenwald und viele Auengewässer sind wieder an die Elbe angeschlossen worden und können nun wieder überschwemmt werden. Wertvolle und auentypische Habitate entwickelten sich und bieten heute vielen seltenen Tier- und Pflanzenarten wie dem Elbebiber, dem Fischotter, dem See- und Fischadler, ebenso Kranich und Schwarzstorch und diversen Amphibien wie Kammmolch, Moorfrosch oder Rotbauchunke ein neues Zuhause. Von der Rückverlegung des Elbedeiches profitiert nicht nur die Natur, sondern auch der Mensch. Wenn sich die Elbe wieder freier ausbreiten kann, sinkt auch der Hochwasserspiegel und es entsteht naturnaher Hochwasserschutz. Das komplette Gebiet wurde somit extrem ökologisch aufgewertet und ist in meinen Augen ein großartiges Beispiel dafür, wie wichtig intakte Ökosysteme als Grundlage unseres Lebens sind.


Die unendlichen Möglichkeiten, die imposanten Gebäude, der Vibe - ich war schon immer ein Großstadtmensch. Selbst wenn mich die Natur mehr als oft zum Staunen bringt und ich Waldspaziergänge immer mehr zu schätzen lerne, falle ich vermutlich auch jetzt nicht in die Kategorie des klassischen Naturburschens, der jede freie Minute beim Waldtanken verbringt. Und dennoch: der Schutz und Wiederaufbau von Ökosystemen hat nichts mit persönlichen Präferenzen zu tun. Er hat nichts damit zu tun, ob man direkt von den Auswirkungen betroffen ist; und nicht einmal damit, ob man sich damit beschäftigen möchte. Wir sind mittlerweile an dem Punkt angekommen, an dem wir es schlicht und ergreifend müssen. Diese Tatsache darf allerdings nicht nur unter Expert*innen und Betroffenen Konsens sein, sondern muss in die breite Masse getragen werden. „Nur gemeinsam können wir es schaffen“ ist in diesem Kontext definitiv nicht einfach nur daher gesagt.


Durchschauen - Begreifen - Verstehen – Umsetzen, unsere Sprache gibt uns ein Gefühl dafür, dass diese verschiedenen Ebenen einen Prozess meinen. Vom optischen Impuls – sehenden Auges wahrgenommen – bis hin zu den Händen, Beinen und dem ganzen Körper. Für mich zeigt dies, dass wir nicht nur denken und Ziele formulieren sollen, sondern gerade das Umsetzen diese Kette vollendet.
Die Massivität der Biodiversitätskrise lässt selbst jene erschrecken, welche sich schon lange mit dem Thema beschäftigen. Laut Forschenden wurde die Pflanzenbiomasse weltweit seit Beginn der Landnutzungsänderung halbiert. Der Rest erklärt sich von selbst.
Alle, die klar sehen, wissen, dass die ökologische Krise eine nie gekannte Kehrtwende von uns verlangt. Und dies ist die Motivation, mit der ich mich mit voller Energie einsetzen möchte. Schon in Goethes Faust klingt an: „Wie alles sich zum Ganzen webt, eins in dem andern wirkt und lebt!“ Und ja, wir Menschen müssen uns als Teil des Ganzen, als ein Glied in der Kette begreifen und mit der ganzen um uns gewebten Struktur allen Lebens uns selber schützen.
Die UN-Dekade vermittelt in der Mitte der Handlungskette zwischen Durchschauenden und Umsetzenden zur Erreichung bestehender Ziele. Besonders die Biodiversität benötigt mehr Aufmerksamkeit, da sie mit der Klimakrise wechselwirkt und eine essentielle Lösungsebene für diese sein muss.


Das Wort Ökosystem kommt aus dem Altgriechischen und setzt sich aus zwei Teilen zusammen: Zum einen „οἶκος” was so viel heißt wie „Haus“ und zum anderen „sýstema“, was sinngemäß „das Zusammengestellte“ bedeutet. Wenn wir heute sehen, wie vielfältige Belastungen diese komplexen Ökosysteme mit ihren ausgeklügelten Nahrungsnetzen und Stoffflüssen ins Wanken bringen, dann sind Ökosysteme plötzlich kein abstrakter Begriff aus Biobüchern mehr, sondern gehen uns alle an. Denn die Folgen ihrer Zerstörung haben auch auf uns gravierende Auswirkungen. Umso wichtiger ist es also, dass die UN-Dekade zur Ökosystemwiederherstellung einen Rahmen schafft, genau dieser Zerstörung entgegen zu wirken. Denn durch die zahlreichen verschiedenen Expertisen, die hier mitwirken, ist die UN-Dekade selbst in gewisser Weise ein „zusammengestelltes Haus“. Das macht mir Mut, denn genau wie Ökosysteme auf einzigartige Weise zusammenwirken, können auch wir, wenn wir alle anpacken, einzigartige Leistungen vollbringen.


Der Klimawandel und der Verlust biologischer Vielfalt stellen uns vor ein Geflecht von eng verknüpften Herausforderungen, die bereits jetzt für große Teile der Weltbevölkerung existenzbedrohliche Konsequenzen nach sich ziehen. Die UN-Dekade zur Wiederherstellung der Ökosysteme bietet die Möglichkeit, durch kollektives Handeln der Akteure aus Wissenschaft, Politik und Gesellschaft Kräfte zu bündeln und diese Anforderung zu bewältigen. Meine Position als junge Partnerin möchte ich deswegen gerne dazu nutzen, um die Partizipation am politischen Diskurs zu Fragestellungen der Erhaltung und Wiederherstellung von Ökosystemen und biologischer Vielfalt zu fördern. Insbesondere möchte ich dazu ermutigen, neuen Innovationen und Hoffnung Raum zu geben sowie aktiv in den Austausch mit anderen Interessierten und zukunftsorientierten Engagierten zu treten. Der Schutz unseres Planeten zur Prävention von noch weitreichenderen und irreversiblen Belastungen der Umwelt sowie die Restauration bereits beeinträchtigter Systeme ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die Bewältigung dieser globalen Herausforderung muss zum einen von politischen Entscheidungsträgern initiiert werden. Zum anderen kann sie jedoch durch das Engagement jedes Einzelnen von uns getragen sowie aktiv mitgestaltet werden.


Wenn ich eine Sache als Klimaaktivistin gelernt habe dann ist es, dass ich nicht alleine bin. Überall gibt es Menschen, die sich die gleichen Gedanken machen und sich genauso um die Zukunft unseres Planeten sorgen, wie ich das tue. Das ist nicht nur beruhigend und motivierend, sondern auch dringend notwendig. Täglich passieren auf der Welt schreckliche Dinge, die einem das Gefühl geben, handlungsunfähig zu sein. Aber das sind wir nicht, solange wir uns mit Anderen zusammenschließen. Auch der Rückgang der biologischen Vielfalt und intakter Ökosysteme könnte niemals von einer einzelnen Person aufgehalten werden. Aber dadurch, dass ganz viele Menschen zusammenhalten, kann es möglich werden, das Schlimmste zu verhindern. Dafür braucht es Organisationen, wie die UN-Dekade, bei der Menschen gemeinsam ein Ziel verfolgen, weil sie es satt haben, die Zerstörung unseres Planeten tatenlos zuzulassen.


Eines der größten Probleme der Welt ist der weltweite Rückgang der Artenvielfalt. Während das Klima global ist und seine Bewahrung die Anstrengung aller Welt bedarf, ist die Biodiversität stets lokal. Daher können wir dem Verlust an Arten und Biomasse erfolgreich vor Ort begegnen und Natur wiederherstellen. Die UN-Dekade zur Wiederherstellung von Ökosystemen wirbt dafür. Jeder instandgesetzte Lebensraum zählt und in ihm jede Art, die eine prägende Rolle im Naturhaushalt hat. Dazu gehören auch die großen Pflanzenfresser, die durch das Kurzhalten von Gehölzen und das mosaikartige Abweiden der Pflanzendecke, über das Offenhalten von Bodenstellen und nicht zuletzt über ihren Dung ganze Lebensgemeinschaften begründen, zu denen viele bedrohte Arten zählen. Über Jahrmillionen haben wilde Großtiere die Ökosysteme geprägt. Später waren es ihre zahmen Nachfahren. Ich freue mich darüber, dass heute immer mehr Schutzgebiete die Beweidung in ihr Konzept integrieren. Dadurch laufen mehr natürliche Prozesse ab, werden die Ökosysteme vollständiger und ihre Artenzahlen steigen sprunghaft an. Die Wiederherstellung der Ökosysteme ist nicht nur eine drängende, sondern auch eine wunderbare Aufgabe, denn im Gegensatz zum Kampf gegen andere Probleme auf der Welt stellen sich hier die Erfolge schnell und sichtbar ein.


Durch meine Aufenthalte in europäischen und außereuropäischen Ländern, sowie durch mein Studium der Forstwirtschaft in Deutschland und der Tropischen Forstwirtschaft in den Niederlanden wurde und werde ich immer wieder Zeugin von der Zerstörung einzigartiger Ökosysteme. Sei es die Abholzung der Regenwälder, das Schmelzen der Gletscher auf Island, die viel zu warmen Winter in der Arktis oder das Austrocknen der heimischen Bachläufe – es gibt nicht einen Ort auf diesem Planeten, an dem die Natur noch in ihrem ursprünglichen Zustand ist.
Die Crux ist ja, dass man vor einem einmal wahrgenommenen Missstand die Augen nur schwer wieder verschließen kann. Und wenn ich eines in meinem noch jungen Leben lernen durfte, dann ist es die Erkenntnis, dass man vor Dingen nicht weglaufen kann.
Ich möchte nicht mehr weglaufen, es ist Zeit, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb ist es eine Ehre für mich, als Junge Partnerin der UN-Dekade Ökosystem-Wiederherstellung zusammen mit anderen ins aktive Handeln zu kommen und mehr Menschen für das Thema Ökosysteme zu sensibilisieren.


Die Erhaltung der natürlichen Ökosysteme gerät in unserer Gesellschaft und Politik oftmals in eine Nebenrolle, dabei sind diese unser aller Lebensgrundlage. Die UN-Dekade erscheint mir als ein wichtiges Instrument für eine nachhaltige und sichere Zukunft für uns alle. Besonders wichtig ist mir die Einbindung von Perspektiven verschiedener Lebensrealitäten in die Wiederherstellung von Ökosystemen in Deutschland. Meine Großeltern kamen als Gastarbeiter*innen nach Deutschland. Sie haben hart gearbeitet, damit ihre Kinder und Enkelkinder eine bessere Zukunft haben. So ist das Thema Zukunft schon immer sehr präsent in meinem Leben, mit dem Anspruch an mich selbst, der nächsten Generation lebenswerte Lebensgrundlagen zu hinterlassen. Das kann ich nicht alleine schaffen, sondern nur mit vielen Menschen zusammen. Damit gemeinsames Handeln funktionieren kann, ist es mein Wunsch, eine offenere Gesellschaft zu gestalten, in der auch Menschen mit Migrationsgeschichte in allen Bereichen gut repräsentiert sind.


Intakte Ökosysteme gehören zu den wertvollsten Schätzen auf unserem Planeten. Leider wurde dieser Schatz in den letzten Jahrzehnten wenig gepflegt, was zu Rückgang und Verschlechterung wertvoller Lebensräume weltweit geführt hat. Und dieser Prozess schreitet aktuell schneller voran denn je und erste spürbare Folgen des Klimawandels zeigen, dass wir dabei sind die Natur, unsere Lebensgrundlage, unwiderruflich zu zerstören, wenn wir uns nicht bald darum kümmern.
Deswegen will ich mich an der Lösung beteiligen und mich für die Wiederherstellung von Ökosystemen einsetzen. Ich komme aus dem landwirtschaftlichen Bereich und sehe, wie sehr sie die Landschaft prägt. Und das ist nicht unbedingt schlecht, denn die Agrar- oder Kulturlandschaft stellt einen essentiellen Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten dar. Nun gilt es diesen Lebensraum zu schützen und die von Monokulturen, Pestizid- und Düngemitteleinsatz geprägte Landwirtschaft so umzubauen, dass sie Lebensräume erhält und eine vielfältige Kulturlandschaft erschafft. Zusammen mit der UN-Dekade Ökosystem-Wiederherstellung möchte ich mich als Junger Partner für diese Transformation engagieren und Menschen für die Lebensgrundlage Ökosysteme sensibilisieren.


„Wir haben diese Welt nicht von unseren Eltern geerbt, sondern von unseren Kindern geliehen“ –
wie wahr diese indianische Weisheit ist.
Was sollen wir essen, wenn alles tot ist? Wohin wollen wir reisen, wenn alles grau ist? Unser Leben und die Natur, die uns umgibt, sind ein Geschenk. Wir sind abhängig von der Natur. Die Natur nährt und beherbergt uns und alle Lebewesen. Stirbt eine Art aus, wird eine Kettenreaktion weiteren Sterbens ausgelöst. Die Ökologische Vielfalt ist daher lebenswichtig für uns alle. Dieser Prozess schreitet voran und das möchte ich nicht blind mitansehen. Es ist höchste Zeit, diese beeindruckende Arten- und Lebensraumvielfalt zu schützen. Denn auch wir sind nur Gäste auf dieser Welt.
Ich empfinde es als meine Aufgabe, Verständnis für die Zusammenhänge der Natur und des Klimawandels mit unserem Leben zu wecken und die Freude an den Überraschungen, die die Natur birgt, weiterzutragen. Auch unsere Nachkommen sollten diese Freude erleben dürfen. Wir alle können dazu beitragen, wenn jeder tut, was er kann. Wenn wir alle im Kleinen dazu beitragen, können wir Großes bewegen! Es ist höchste Zeit.
Wir haben die Möglichkeit, das Ruder rumzureißen. Worauf warten wir?


„Wenn ich mich mit der Renaturierung von Ökosystemen beschäftige, habe ich das Gefühl, die
Weltuntergangsstimmung, die zurzeit noch – absolut zurecht - in Nachhaltigkeitsdebatten
vorherrscht, ein Stück weit hinter mir zu lassen und proaktiv an einer positiven Veränderung
mitzuwirken. Wie vielen anderen jungen Menschen ist es natürlich auch mir ein Anliegen auf
Grundlage der zahlreichen Problemanalysen, die uns mittlerweile vorliegen, nun wirklich ins Handeln
zu kommen und eine zukunftsfähige Gesellschaft zu schaffen. Dazu gehört auch, dass unsere
Lebensweise nicht mehr dazu führt, dass Ökosysteme durch sie degradiert oder ganz zerstört werden.
Um dies zu erreichen, sehe ich einerseits eine große Verantwortung bei politischen
Entscheidungsträger*innen die dafür so dringend benötigten Rahmenbedingungen zu schaffen.
Andererseits ist es gleichzeitig notwendig, in der Gesellschaft das Bewusstsein dafür zu stärken, dass
intakte Ökosysteme nicht nur als Naherholungsgebiete für einen Sonntagsspaziergang taugen,
sondern eine entscheidende Rolle bei der Minderung der Klimakrise und des Verlusts der Artenvielfalt
spielen.“


Alle Menschen heute und alle nachfolgenden Generationen sind auf die Erhaltung der biologischen Vielfalt angewiesen. Auf jeder Ebene – von den Kommunen bis zu den überstaatlichen Institutionen wie den Vereinten Nationen – muss daran gearbeitet werden, die Umwelt, die natürlichen Lebensgrundlagen, die Artenvielfalt zu schützen. Das Land Hessen leistet dazu seinen Beitrag. Schon seit 1991 ist der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen als Staatszielbestimmung in der Hessischen Verfassung verankert. Später war nicht zuletzt die „UN-Dekade biologische Vielfalt 2011 bis 2020“ für Hessen Anlass, die zahlreichen Maßnahmen und Instrumente in einer eigenen Biodiversitätsstrategie zu bündeln und weiterzuentwickeln.
Die UN-Dekade zur Wiederherstellung von Ökosystemen 2021–2030 setzt die internationalen Anstrengungen fort. Hessen wird weiter seiner Verantwortung zur Erhaltung der biologischen Vielfalt nachkommen. Wir schützen damit unser Leben und unsere Zukunft.


Langsam müsste jedem klar sein, wie wichtig Biologische Vielfalt für uns ist. Jeder Lebensbereich hängt mit der Biodiversität zusammen: Sei es das Wohnen, das Reisen, unser Essen, unsere Gesundheit und unsere Sicherheit: Stichwort Naturkatastrophen oder Extremwetterereignisse. Die Vielfalt von Ökosystemen, die Vielfalt der Arten und genetische Vielfalt sind die Grundlage unseres Lebens. Und unseres Überlebens. Auf Grundlage dieser Gewissheit müssen wir nun dafür sorgen, Ökosysteme zu schützen und sie wieder herzustellen. Sie sind gefährdet, denn um den Raum, der uns zur Verfügung steht, konkurrieren viele Interessengruppen: Es geht um Wohnen, Arbeiten, um Mobilität und Freizeit. All diese Bereiche lassen sich ökonomisieren. Die Natur darf darüber bei der Raumaufteilung nicht aus dem Blickfeld geraten. Sie ist schließlich unsere Lebensgrundlage. Ich möchte als Partnerin der UN-Dekade Ökosystem-Wiederherstellung dem Thema Raum verschaffen, indem ich immer wieder darauf aufmerksam mache und sensibilisiere.


Hautnahe Kontakte in und mit der Natur sind für Kinder oft prägend und können dazu beitragen, dass sich bei ihnen Liebe und Vertrautheit zur Natur entwickelt. Ich selbst erinnere mich noch gerne an solch intensive Begegnungen in meiner Kindheit, auch wenn sie manchmal ziemlich abenteuerlich endeten. Wir hatten das Glück, dass die Eltern sich immer wieder die Zeit nahmen uns viel zu erklären, meine Brüder und mich bei jedem Wetter nach draußen schickten und großes Vertrauen in uns hatten. Damals wurde der Grundstein für meine Faszination für die Natur gelegt, die ich in ähnlicher Weise auch an meine Kinder weitergeben konnte.
Um allen Kindern, besonders Stadtkindern, aber auch Erwachsenen heute nachhaltig beeindruckende Naturkontakte zu ermöglichen, betreibe ich meinen „Garten der Schmetterlinge Schloss Sayn“, in dem etwa 1000 tropische Schmetterlinge leben. Hier schweben große, farbenprächtige Falter durch die Lüfte, saugen Nektar aus Blüten oder von Früchten und landen mitunter auf den Besuchern. Dieser hautnahe Kontakt mit den fragilen Schmetterlingen fasziniert Groß und Klein und weckt Interesse für die Umwelt, die Artenvielfalt und für den Erhalt natürlicher Lebensräume.


Beruflich reise ich sehr intensiv und seit vielen Jahren durch Deutschland und nehme sowohl die sehr positiven Landschaften als auch sehr Negative wahr. Positiv empfinde ich zum Beispiel den gewaltigen Umbau der einstigen Fichtenmonokultur im jetzigen Nationalpark Bayerischer Wald zum vorbildhaften Mischwald. Erst vor sehr kurzer Zeit besuchte ich den Park wieder und bei jedem Schritt empfand ich Freude, Genugtuung und Dankbarkeit für ein solches Füllhorn der Natur. Ja, es hat 50 Jahre gedauert, aber es hat sich gelohnt. Der gleiche Erfolg spriesst auch in anderen Großschutzgebieten wie z. B. Im Hainich Nationalpark oder im Kellerwald-Edersee. „Natur-Natur sein lassen“ ist wirklich ein goldwerter Satz der einfach „ausgesessen“ werden muss um zukünftigen Generationen eine naturverbundene Welt zu hinterlassen. Es ist möglich. Wir müssen es mit langem Atem nur wollen. Ich werde es durch Bücher und Vorträge in meinen Bereichen unterstützen. Als negativ empfinde ich den zum Teil radikalen Einsatz der sog. Harvester in unseren Wäldern. Sie fahren einfach geradeaus in die Wälder, ohne Rücksicht auf Verluste und verdichten den Boden.


Meine Arbeit treibt mich immer wieder hinaus in die weite Welt. Ich begegne Menschen, Landschaften, Tieren und Pflanzen. Moment! Welche ist die richtige Reihenfolge, wenn ich diese vier aufzähle? Wer war zuerst da? Es sollte wohl eher heißen: Landschaften, Pflanzen, Tiere und Menschen. So sehr ich Menschen liebe, gleichermaßen bringen mich die Menschen (klar, ich bin auch einer) zur Verzweiflung. Wir sind schlau, sozial und mitfühlend, aber wir sind diejenigen, die als allerletzte dazugekommen sind. Und was machen wir? Alles, nein noch nicht alles, aber so viel kaputt. Dennoch bleibe ich hoffnungsvoll! Weil es Kinder gibt. Sie können neue Wege einschlagen.


Wir haben derzeit andere Sorgen, als uns um biologische Vielfalt, um Ökosysteme kümmern zu wollen? Ich denke: Das ist viel zu kurz gedacht. Weshalb nicht „Sowohl – als auch“? Niemand will sich einer Energiekrise ausliefern oder Angriffskriege einfach hinnehmen – und Wege aus einer Inflation suchen wollen wir auch. UND da ist der explodierende Verlust der Artenvielfalt, der Insekten, Vögel, Würmer, Waldbewohner, der fantastischen Pflanzen und Tiere auf unserem Planeten. Auch und gerade DAS können wir nicht einfach geschehen lassen. Lasst uns in Lösungen denken und an vorbildlichen Projekten lernen. Das ist das beste Mittel gegen Ohnmacht und Angst. Besonnenes Handeln hebt uns in den Driverseat der Zukunftsgestaltung. Und deshalb setze ich mich seit vielen Jahren genau dafür ein: Die hunderttausend Möglichkeiten zu erkennen – und sie zu nutzen, um die biologische Vielfalt, die Ökosysteme zu schützen und zu regenerieren. Ich tue, was ich kann – und DU – willst das auch?
Also: Alles wird gut! Aber nicht von alleine!


Okay, zugegeben, “UN-Dekade Ökosystem-Wiederherstellung 2021 bis 2030” hört sich nicht besonders sexy an. Ist sie aber! Denn wir erleben gerade das schlimmste Artensterben seit dem Verschwinden der Dinosaurier. Und wenn wir das nicht in den Griff bekommen, wird es auch Homo sapiens irgendwann schlecht ergehen. Also müssen wir die Biodiversität schützen. Und der beste, der wirklich allerbeste Weg, um die Artenvielfalt auf der Erde zu erhalten, ist die Wiederherstellung der Ökosysteme. Gelingt das auf globaler Ebene, kann die Natur uns Menschen weiter das geben, was wir zum Leben brauchen: Atemluft, Trinkwasser, Nahrung und auch ein bisschen Glück.


Ich freue mich, neben der Ozeandekade ebenfalls für die UN-Dekade zur Wiederherstellung von Ökosystemen sprechen zu dürfen. 83 Prozent der Erdoberfläche werden inzwischen von uns Menschen genutzt. Wir dringen in immer entlegenere Regionen vor, die letzten Rückzugsgebiete von Tieren und Pflanzen. Im Umkehrschluss bedeutet das: Wir können diesen Weg auch zurückgehen. Wir müssen die Ökosysteme unseres Planeten bewahren.